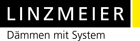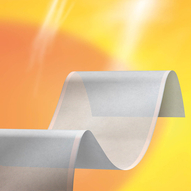Kapillaraktive Innendämmung für wohngesundes Raumklima
Diffusionsoffene Innendämmung verhindert Schimmelbildung
Das Dämmen von innen ist anspruchsvoll und zwingend nach den jeweiligen Herstellervorgaben auszuführen. So kann bei einer nicht fachgerechten Ausführung feuchtwarme Luft in die Konstruktion eindringen, kondensieren und Schimmel hervorrufen. Eine kapillaraktive Innendämmung beugt dem vor, denn diese ist diffusionsoffen. Sie nimmt Feuchtigkeit aus dem Raum auf, puffert diese ab oder zwischen und gibt sie erst dann wieder an die Raumluft ab, wenn sich das Feuchteniveau im Raum gesenkt hat.
Die kapillaraktive Innendämmung reguliert den Feuchtegehalt der Raumluft und sorgt so für ein hohes Maß an Sicherheit in Bezug auf Feuchtigkeits- und Schimmelschäden. Möglich ist das durch zahlreiche Poren im Material, die Wasserdampf aufnehmen und speichern. Sind die raumklimatischen Gegebenheiten günstig, erfolgt ein kapillarer Rücktransport der Feuchte an die raumseitige Oberfläche. Dort verdampft sie und entweicht über das normale Lüften des Raums aus dem Haus. Sanierer und Bauherren profitieren bei der kapillaraktiven mineralischen Innendämmung von drei Vorteilen:
- Hoher Schutz vor Schimmel durch trockene Oberflächen und ein häufig basisches Milieu des Innendämmsystems
- Gesundes Raumklima durch eine optimale Raumluftfeuchtigkeit
- Hohes Sicherheitspotential und Langlebigkeit
Die kapillare oder diffusionsoffene Innendämmung gleicht die Nachteile und Risiken konventioneller Innendämmsysteme aus. Sie ist ohne Gerüst Raum für Raum zu verarbeiten und stellt somit eine wirtschaftliche Lösung zur Dämmung von innen dar.
Montage ohne Dampfbremse reduziert Risiko von Bauschäden
Klassische Innendämmsysteme bestehen meist aus einer Trockenbaukonstruktion und einer Dampfbremse bzw. -sperre als luftdichte Ebene. Letztere soll verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt und dort auskondensiert. Sie lässt sich in der Praxis aber nur schwer dauerhaft dicht anbringen, sodass immer ein Restrisiko bestehen bleibt. Die diffusionsoffene und kapillaraktive Innendämmung wird dagegen vollflächig auf der Innenseite der Außenwand verklebt und raumseitig verputzt. Sie funktioniert ohne luftdichte Ebene und lässt sich somit einfacher und schneller verarbeiten. Zusammen mit einem fachgerecht erstellten dünnschichtigen Innenputzsystem entstehen auf diese Weise robuste und druckfeste Oberflächen. Die zur Verfügung stehenden Putze erlauben einen großen Gestaltungsspielraum. Sie werden vielen Ansprüchen gerecht, klingen massiv wie monolithische Wände und sorgen so für ein angenehmes Raumgefühl.
Verschiedene Materialien für die kapillaraktive Dämmung geeignet
Für die kapillare Innendämmung kommen verschiedene Dämmstoffe zum Einsatz. Ein Beispiel sind Kalziumsilikat-Platten, die viel Feuchtigkeit aufnehmen, aber nur eingeschränkt vor Wärmeverlusten schützen. Dämmplatten aus Kunststoffschäumen transportieren weniger Wärme nach draußen, haben dafür aber ein geringeres Speichervermögen für Feuchtigkeit. Mineralische Dämmplatten vereinen die Vorteile beider Produktarten: Sie haben ein hohes Speicher- und Rücktrocknungsvermögen für Feuchtigkeit, schützen durch eine geringe Rohdichte effektiv vor Wärmeverlusten und sind zudem nicht brennbar. Der gute Wärmeschutz sorgt dafür, dass niedrige U-Werte auch mit moderaten Wandstärken zu erreichen sind. Eine Eigenschaft, die zu sinkenden Heizkosten und CO2-Einsparungen beiträgt.
Diffusionsoffene Innendämmung nicht nur für die Sanierung im Denkmal
Die kapillaraktive Innendämmung ist zu empfehlen, wenn eine Außendämmung nicht infrage kommt. So zum Beispiel bei der Dämmung denkmalgeschützter und/oder erhaltenswerter Fassaden. Auch bei der Kellerdämmung von innen kommt das System infrage, etwa um bisher ungenutzte Räume zu beheizten Hobby-, Wohn- oder Gästezimmern auszubauen. Weitere Einsatzgebiete finden sich bei der Dämmung von Fachwerkhäusern und der Schimmelsanierung. Eine Alternative zum Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) stellt die diffusionsoffene Dämmung darüber hinaus auch dann dar, wenn sich das WDVS bei Grenzbebauung nicht ohne Weiteres anbringen lässt.
Für alle, die's genauer wissen wollen: Broschüre 'Was ist Kapillaraktivität?'
Sanierungsforum
Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten
Energieberater-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort
Produkte im Bereich Innendämmung
Produkte im Bereich Innendämmung
Sanierungsforum
-
Bekomme ich die Förderung neuer Fenster auch, wenn ich nur zwei Fenster austausche?
Sofern Sie die Mindest-Investitionskosten (300 Euro seit 2024) übersteigen, bekommen Sie die Förderung auch für einzelne Fenster. ...
Antwort lesen » -
Die Fassadendämmung im EG ist durch das Erdreich sehr schwierig. Gibt es eine Alternative zur Perimeterdämmung?
Die Förderung der Fassadendämmung bekommen Sie auch ohne die Dämmung der einen Orientierung. Denn diese gibt es nur für die tatsächlich ...
Antwort lesen » -
Wie hoch sind die förderbaren Kosten für eine neue Wärmepumpe im Haus mit Einliegerwohnung?
Bei zwei Wohneinheiten können Sie insgesamt Kosten in Höhe von 45.000 Euro anrechnen. 30.000 Euro für die erste und 15.000 Euro für die ...
Antwort lesen » -
Kann der Energieberater den iSFP anpassen, wenn sich unsere Pläne geändert haben?
Der bereits beauftragte Energieberatung kann die vorhandene Berechnung mit einem vergleichsweise geringen Aufwand anpassen und einen neuen ...
Antwort lesen » -
Wir haben vor der Antragstellung 2024 mit der geförderten Maßnahme begonnen. Gibt es dennoch eine Förderung?
Die BEG-EM-Förderung für neue Fenster bekamen Sie letztes Jahr leider nur, wenn Sie noch keine Maßnahme begonnen hatten. Auch in diesem ...
Antwort lesen » -
Gelten die GEG-Vorgaben für die Dachdämmung für jedes Dach?
Die GEG-Vorgaben zur Dachsanierung betreffen immer nur die tatsächlich behandelten Bauteile. Sanieren Sie das erste Dach, müssen Sie durch ...
Antwort lesen » -
Bekomme ich die Förderung der Dachdämmung auch für die Eindeckung?
Beantragen Sie die Förderung der Dachdämmung, können Sie alle anfallenden Umfeldmaßnahmen ebenfalls mit angeben. Das heißt: Die Förderung ...
Antwort lesen » -
Wie hoch ist die Förderung für neue Fenster im Mehrfamilienhaus mit 24 Wohneinheiten?
Beantragen Sie einen BEG-EM-Zuschuss für neue Fenster, liegt die Förderrate bei 15 Prozent. Bezogen auf die anrechenbaren Kosten von 82.000 ...
Antwort lesen » -
Wer zahlt die neue Heizung im 3-Parteien-Haus einer Wohnungseigentümergemeinschaft?
Geht es um die Heizkosten, entscheidet der messbare Verbrauch. Bei allen anderen Kosten kommt es auf den Gemeinschaftsvertrag und die ...
Antwort lesen » -
Müssen wir die Fassade dämmen, wenn wir die Holzvertäfelung entfernen und alles neu verputzen?
Nach Anlage 7 GEG ist die Dämmung der Fassade Pflicht, wenn Sie Bekleidungen (Platten oder plattenartige Bauteile), Verschalungen, ...
Antwort lesen » -
Sollte ich die Garage dämmen oder genügt es, die Trennwand zwischen Garage und Haus mit Dämmung zu versehen?
Soll die Garage weiterhin größtenteils unbeheizt bleiben, ist eine Dämmung der Außenwände nicht nötig. Sinnvoll ist allerdings eine Dämmung ...
Antwort lesen » -
Zählt das Einkommen meiner Lebensgefährtin auch, wenn ich den Einkommensbonus zur Heizungsförderung nutzen möchte?
Relevant für den Einkommensbonus zur Heizungsförderung ist das Einkommen des selbst nutzenden Eigentümers. Außerdem ist das Einkommen eines ...
Antwort lesen » -
Ist unsere Tochter nach der Übertragung des Hauses zur Dachdämmung verpflichtet?
Das ist generell nicht erforderlich. Eine Pflicht zur Dämmung des Daches gibt es nur, wenn Sie auch Maßnahmen am Dach ausführen. Welche das ...
Antwort lesen » -
Muss nach der Installation der Wärmepumpe die alte Gasheizung ausgebaut werden oder reicht die Abmeldung vom Gasbetreiber?
Das hängt von der Förderung der Wärmepumpe ab. Haben Sie keine Fördermittel oder nur die Basis-Förderung beantragt, können Sie die ...
Antwort lesen » -
Gelten die Ausnahmen von der GEG-Austauschpflicht für Heizungen für Öl- und Gasheizungen?
Die Ausnahmen von der Austauschpflicht für Heizungen im GEG für Niedertemperatur- und Brennwertheizungen gelten sowohl für Öl- als auch für ...
Antwort lesen » -
Darf auch ein Fachunternehmen Fachplanung und Baubegleitung übernehmen?
Bei einem geförderten Heizungstausch kann auch die Fachfirma die Arbeiten planen und überwachen. Zudem sind Fachunternehmer in diesem Fall ...
Antwort lesen » -
Lohnt sich die Kellerdeckendämmung?
Ist der Keller unbeheizt, geht weniger Wärme aus dem Erdgeschoss an diesen verloren. Das reduziert zum einen die Energiekosten. Zum anderen ...
Antwort lesen » -
Darf ich die Förderung der Sanierung jedes Jahr erneut beantragen?
Das ist möglich. Relevant ist nicht, wann Sie die Arbeiten umsetzen, sondern in welchem Kalenderjahr Sie diese beantragen. Beachten Sie ...
Antwort lesen » -
Kann ich die Photovoltaikanlage bei der Förderung der Biomasseheizung angeben, auch wenn diese nicht mir gehört?
Wenn Ihnen der Strom der PV-Anlage zur Verfügung steht (Mietanlage) und der Ertrag ausreicht, um den Energiebedarf der Warmwasserbereitung ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Förderung für die Dachsanierung?
Eine Förderung für die Dachsanierung erhalten Sie über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), den Steuerbonus für die Sanierung ...
Antwort lesen » -
Bekomme ich die Förderung für eine neue Heizung ohne Entsorgungsnachweis für die alte Ölheizung?
In diesem Fall bekommen Sie zwar die Förderung der neuen Heizung. Den Geschwindigkeitsbonus erhalten Sie jedoch nicht. Denn dieser setzt ...
Antwort lesen » -
Kann ich an der Traufe des Reihenmittelhauses einen Schornstein anbringen?
Hier gelten die Ableitbedingungen für Schornsteine aus der 1. BImSchV (Absatz 2 aus § 19 der 1. BImSchV). Die Austrittsöffnung muss demnach ...
Antwort lesen » -
Mussten wir die alte Ölheizung bereits austauschen? Welche Möglichkeiten haben wir heute?
Während Alteigentümer in vielen Fällen von der Austauschpflicht im GEG befreit sind, greift diese nach einem Eigentumsübergang. Die neuen ...
Antwort lesen » -
Kann ich eine bestehende Dämmung bei der Dämmpflicht an der obersten Geschossdecke anrechnen?
Ja, das ist möglich. Denn das GEG fordert hier einen bestimmten U-Wert. Diesen erreichen Sie immer mit dem gesamten Bauteilaufbau (neu und ...
Antwort lesen » -
Wie oft kann ich Fördermittel für eine neue Heizung beantragen?
Sie können die Heizungsförderung generell so oft beantragen, wie Sie möchten. Wichtig ist, dass Sie die förderbaren Kosten nicht ...
Antwort lesen » -
Müssen wir für den Geschwindigkeitsbonus zur Pelletheizung eine neue Solaranlage installieren?
Die Solaranlage muss nicht neu installiert werden. Sie muss aber ausreichend groß dimensioniert sein, um den Bedarf der Warmwasserbereitung ...
Antwort lesen » -
Unsere Tochter ist Eigentümer. Ich habe Nießbrauchrecht. Wer darf welche Fördermittel beantragen?
Als Eigentümerin kann Ihre Tochter alle Fördermittel beantragen (ausgenommen Steuerboni). Geht es um die Heizungsförderung (auch für die ...
Antwort lesen » -
Ich plane eine Heizungssanierung. Soll ich die neue Wärmepumpe mit einer Solaranlage oder einer Wärmepumpe kombinieren?
Eine fundierte Antwort lässt sich ohne genaue Kenntnisse vom Haus und von dessen Nutzung leider nicht geben. Diese bekommen Sie nur von ...
Antwort lesen » -
Muss ich meine PV-Anlage beim Finanzamt anmelden und kann ich auf die Kleinunternehmerregelung verzichten?
Die Anmeldung der PV-Anlage beim Finanzamt ist auch mit Steuerbefreiung für die PV Pflicht. Nach Aussagen des Bundesfinanzministeriums ...
Antwort lesen » -
Wie weise ich die Anzahl der Wohneinheiten in meinem Haus nach?
Den Nachweis erbringen Sie in der Regel mit einem Grundbuchauszug. Möchten Sie den Einkommens- oder Geschwindigkeitsbonus nutzen, ist das ...
Antwort lesen »
Unsere Portalpartner
Handwerker-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort






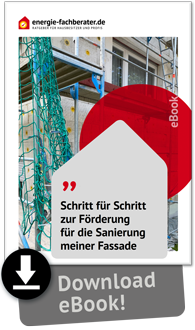
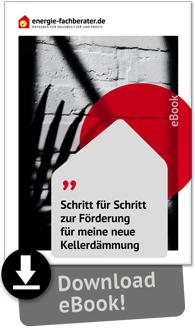
 Hier finden Sie die passenden Innentüren
Hier finden Sie die passenden Innentüren Jetzt Fachhandwerker vor Ort für die Dämmung Ihrer Fassade finden
Jetzt Fachhandwerker vor Ort für die Dämmung Ihrer Fassade finden