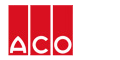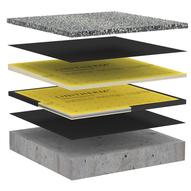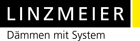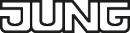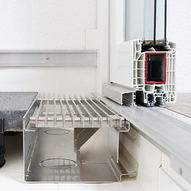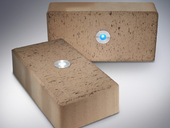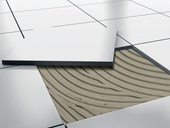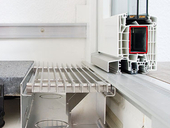Ein Windrad im Garten – lohnt sich das?
Strom ernten auf dem eigenen Grundstück
Die Energiekosten für Strom und Wärme verursachen schon heute einen großen Anteil der monatlichen Ausgaben. Mit der Befürchtung, die Preise könnten immer weiter steigen, wünschen sich viele Haushalte mehr Unabhängigkeit von großen Energieversorgern. Eine Möglichkeit, den im Haus benötigten Strom selbst zu erzeugen, bietet die Kleinwindkraft. Aber lohnt es sich überhaupt, ein Windrad im eigenen Garten aufzustellen? Alle Infos zu Möglichkeiten, Voraussetzungen, Kosten und Förderung.
Kleinwindkraft – was ist das eigentlich?
Wie die großen Windkraft-Anlagen, die heute überall in Deutschland zu finden sind, nutzen auch die kleinen Windräder die unsichtbare Kraft des Windes zur Erzeugung von Strom. Das funktioniert in etwa wie bei einem Fahrrad-Dynamo. Der Wind versetzt mehrere, um eine Achse angebrachte Rotoren in eine Drehbewegung, durch die ein Generator elektrische Energie erzeugt. Typisch für die kleinen Windräder, die oft nicht mehr als 30 Kilowatt leisten, ist die unmittelbare Nähe zu Verbrauchern. Die Anlage für ein Einfamilienhaus könnte dabei zum Beispiel im Garten oder auf dem Dach installiert werden.
Welche Arten von kleinen Windrädern gibt es?
In der Kleinwindkraft unterscheidet man zwischen horizontalen und vertikalen Windrädern. Horizontale Anlagen, bei denen sich die Rotoren um eine liegende Achse drehen, funktionieren dabei genau wie große Anlagen. Sie bringen die meiste Leistung, wenn sie optimal im Wind stehen und müssen diesem daher immer nachgeführt werden. Vertikale Windräder, bei denen sich die Rotoren um eine aufrecht stehende Achse drehen, laufen dagegen, egal, aus welcher Richtung der Wind weht. Sie sind zwar weniger anfällig für starke Böen, arbeiten leiser und erzeugen kaum Vibrationen, haben dafür aber auch einen geringeren Wirkungsgrad. Bei gleicher Windstärke erzeugen vertikale Windräder also weniger Strom als horizontale.
Gleich nach passendem Windrad schauen und Preise vergleichen!
Wie viel Wind braucht das Windrad im Garten?
An einem Mast im Garten oder auf dem Hausdach installiert, können kleine Windkraftanlagen einen Teil des Strombedarfs im eigenen Haushalt decken. Anders als bei Photovoltaik-Anlagen – die elektrische Energie aus der Sonne gewinnen – funktioniert das auch nachts. Die einzige Voraussetzung: Der Wind muss wehen. Und das in einer ausreichenden Stärke. Denn Kleinwindkraft-Anlagen drehen sich zwar oft schon bei ruhigem Wind, entfalten ihre volle Leistung aber erst bei Geschwindigkeiten ab 10 m/s. Ohne Messinstrumente erkennt man das zum Beispiel daran, dass der Wind bereits deutlich hörbar ist und sich an den Bäumen auch größere Zweige bewegen. Bei schwachen Brisen, also immer dann, wenn sich Blätter und dünne Zweige an den Bäumen in der Umgebung bewegen, kommen Kleinwindräder oft nur auf etwa 20 Prozent ihrer Leistung. Ein Windrad, das nach Herstellerangabe 1.000 Watt erzeugen kann, würde dabei gerade einmal 200 Watt leisten. Zum Vergleich: Ein neuer Kühlschrank mit Gefrierfach – ein Dauerverbraucher im Haushalt - benötigt etwa 150 Watt.
Lohnt sich ein kleines Windrad im Garten?
Ob sich ein Windrad im eigenen Garten lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Weil jede Kilowattstunde, die in das öffentliche Netz eingespeist wird, nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) mit nur etwas mehr als 6 Cent vergütet wird, sollten kleine Windräder immer zum Eigenverbrauch eingesetzt werden. Denn dann muss weniger Strom vom Versorger eingekauft werden. Wirtschaftlich ist eine Kleinwindkraft-Anlage dabei immer dann, wenn die Gestehungskosten des selbst erzeugten Stroms – also die Kosten für Installation und Betrieb des Windrades – niedriger sind als die Preise für Strom aus dem öffentlichen Netz. Während kleine Windkraftanlagen in einer für Einfamilienhäuser typischen Größe von 1 bis 1,5 Kilowatt bereits ab 3.000 Euro erhältlich sind, hängt die mögliche Einsparung meist allein von der Windgeschwindigkeit am Aufstellort ab. Ob sich eine Windkraftanlage lohnt, kann dabei nur nach einer Windmessung gesagt werden. Diese wird oft von den Anbietern der Kleinwindkraft-Anlagen selbst übernommen.
Wieviel Strom kann ein privates Windrad erzeugen?
Neben dem Standort entscheidet auch die Wahl des passenden Windrads darüber, ob die eigene Anlage erfolgreich arbeiten kann. Inzwischen bieten viele Hersteller Mini-Windkraftanlagen an. Die Anlage muss zum Windangebot des Standortes passen. Wenn wirklich alles stimmt, kann es klappen mit dem eigenen Wind-Strom: Eine gute Kleinwindanlage von 1,5 Kilowatt Nennleistung kann an einem Standort mit gutem Wind (mittlere Windgeschwindigkeit 4 Meter pro Sekunde) etwa 1.500 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen.
Worauf sollte man beim Kauf kleiner Windräder achten?
Wer sich für den Kauf einer Kleinwindkraft-Anlage entschieden hat, sollte einige Punkte beachten. Zum einen muss geprüft werden, ob für die Aufstellung eine Baugenehmigung beantragt werden muss. Aufschluss darüber geben die Bauordnungen der Bundesländer. In vielen ist die Aufstellung von Windkraftanlagen bis zu einer Höhe von 10 Metern frei. Soll das Windrad auf dem Hausdach installiert werden, ist es sinnvoll vorher einen Statiker zurate zu ziehen. Denn vor allem horizontale Windräder können im Betrieb Vibrationen erzeugen, die das Bauwerk nicht beeinträchtigen dürfen. Auch die Geräusche, die von den rotierenden Anlagen ausgehen, müssen innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen bleiben. Diese werden über die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - kurz TA Lärm – geregelt.
Bei den Windrädern selbst stehen transparente Erfahrungswerte, Testberichte unabhängiger Institute und Bewertungen unabhängiger Branchen-Experten für eine hohe Qualität. Verbrauscherschützer raten Eigentümern darüber hinaus zu gesunder Skepsis, wenn Hersteller damit werben, dass ihre Windräder durch besonderes Design besonders viel Strom erzeugen können. Selbst die beste Anlage kann nicht mehr Energie aus dem Wind herausholen als drin ist. Doppelte Windgeschwindigkeit bringt den achtfachen Ertrag - die halbe nur ein Achtel, ganz gleich, wie ausgetüftelt das Windrad ist.
Gleich nach passendem Windrad schauen und Preise vergleichen!
Was ist der richtige Standort für ein Windrad?
Sinnvoll ist eine kleine Windanlage nur dann, wenn der Standort sehr gut geeignet ist und in der Hauptwindrichtung möglichst keine Hindernisse den Wind ausbremsen. Der Wind sollte sozusagen Anlauf nehmen können, damit die Kleinwindkraftanlage optimale Erträge bringt. Im ungünstigen Fall stören jeder Strauch und jedes Haus. Und schon ein Wäldchen in 50 Metern Entfernung macht den Standort ungünstig. Wer in Küstennähe oder exponiert auf der Höhe wohnt, hat grundsätzlich bessere Voraussetzungen. Aber auch hier gilt: Vor und hinter dem Windrad müssen freie Flächen vorhanden sein.
Gibt es eine Förderung für ein privates Windrad?
Für die Finanzierung von Kleinwindkraft können Eigentümer:innen einen Förderkredit der KfW nutzen. Im Programm 270 "Erneuerbare Energien Standard" werden unter anderem Anlagen zur Stromerzeugung aus Windkraft gefördert. Bis zu 100 Prozent der Investionskosten können mit einem Darlehen der KfW finanziert werden, maximal sind 50 Millionen Euro pro Vorhaben zu günstigen Konditionen möglich.
Viele weitere hilfreiche Informationen zu Kosten und Wirtschaftlichkeit finden Eigentümer in der Broschüre "Kleinwindenergieanlagen" der Energieagentur NRW.
Sanierungsforum
Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten
Energieberater-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort
Produkte im Bereich Grundstück & Garage
Produkte im Bereich Grundstück & Garage
Sanierungsforum
-
Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?
Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...
Antwort lesen » -
Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?
Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?
Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung er Wärmepumpe in Anspruch nehmen. Sie ...
Antwort lesen » -
Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?
Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...
Antwort lesen » -
Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?
Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...
Antwort lesen » -
Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.
Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn Sie oder das Dach ...
Antwort lesen » -
Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?
Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...
Antwort lesen » -
Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?
Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...
Antwort lesen » -
Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?
Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...
Antwort lesen » -
Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?
Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...
Antwort lesen » -
Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?
Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...
Antwort lesen » -
Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?
Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...
Antwort lesen » -
Ist meine Mutter zum Sanieren des Gebäudekomplexes verpflichtet, nachdem sie alleinige Eigentümerin wurde?
Die Ausnahmen von den Nachrüstpflichten des GEG gelten nur für Ein- und Zweifamilienhäuser, die ein Eigentümer am 01. Februar 2002 selbst ...
Antwort lesen » -
Warum gibt es keine Förderung der Kermi-Wärmepumpe mit R 32?
Aus der Liste förderbarer Wärmepumpen geht hervor, dass es die Förderung für Wärmepumpen auch für Geräte von Kermi gibt. Das gilt auch für ...
Antwort lesen » -
Welche Dampfbremse soll unter der Kellerdeckendämmung angebracht werden?
Als neutrale Onlineplattform bieten wir selbst keine Baustoffe an. Diese bekommen Sie aber von einem Baustofffachhandel aus Ihrer Region. ...
Antwort lesen » -
Muss unser Sohn die Gasheizung austauschen, wenn wir diese jetzt einbauen und danach das Haus auf ihn übertragen?
Die Heizung darf auch nach der Übertragung des Eigentums bestehen bleiben. Es gelten aber bereits jetzt die Vorgaben des ...
Antwort lesen » -
Bekommt man den Geschwindigkeits-Bonus zur Heizungsförderung auch, wenn die Gasheizung noch keine 20 Jahre alt ist?
Handelt es sich um eine Zentralheizung (keine Etagenheizung), gibt es den Geschwindigkeits-Bonus zur Förderung der Wärmepumpe erst, wenn ...
Antwort lesen » -
Wie beantragen wir die Heizungsförderung im Haus mit zwei Eigentumswohnungen?
Aktuell können Sie hier leider noch keine Anträge stellen, da das entsprechende KfW-Portal noch nicht fertig gestellt wurde. ...
Antwort lesen » -
Bekommen wir die BAFA-Förderung für die Sanierung eines Hauses mit 7 Ferienwohnungen?
In diesem Fall handelt es sich nicht um ein Gebäude, das in den Geltungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes fällt (siehe Ausnahmen § 2 GEG ...
Antwort lesen » -
Wie hoch ist die Förderung für eine neue Heizung im Mehrfamilienhaus?
Gehört das Haus Ihrem Vater, muss dieser die Förderung für die Wärmepumpe als Eigentümer beantragen. Bewohnt er eine Wohnung selbst, ...
Antwort lesen » -
Können wir bei der BEG-Förderung zur schlechteren Effizienzhaus-Stufe wechseln, wenn wir die Vorgaben nicht erfüllen?
Ja, das gilt nach wie vor. Sie können im Laufe des Fördervorhabens zur schlechteren Stufe wechseln. Andersherum funktioniert das jedoch ...
Antwort lesen » -
Können wir das Dach mit Teerpappe wie geplant von innen dämmen?
Bei fachgerechter Ausführung ist die geplante Konstruktion möglich. Als Dampfbremse könnten Sie sich allerdings für eine feuchtevariable ...
Antwort lesen » -
Welche Auflagen kommen auf meinen Sohn zu, wenn ich ihm unser Haus überschreibe?
Hier ist erst einmal mit keinen Auflagen zu rechnen. Möglicherweise muss die oberste Geschossdecke gedämmt werden, wenn diese frei ...
Antwort lesen » -
Was ist beim Kauf eines Hauses mit Ölheizung zu beachten?
Handelt es sich um eine Niedertemperatur- oder Brennwerttherme, wovon man bei dem Baujahr ausgehen kann, ist erst einmal nichts zu ...
Antwort lesen » -
Bekomme ich die Förderung neuer Fenster auch, wenn ich nur zwei Fenster austausche?
Sofern Sie die Mindest-Investitionskosten (300 Euro seit 2024) übersteigen, bekommen Sie die Förderung auch für einzelne Fenster. ...
Antwort lesen » -
Die Fassadendämmung im EG ist durch das Erdreich sehr schwierig. Gibt es eine Alternative zur Perimeterdämmung?
Die Förderung der Fassadendämmung bekommen Sie auch ohne die Dämmung der einen Orientierung. Denn diese gibt es für die tatsächlich ...
Antwort lesen » -
Wie hoch sind die förderbaren Kosten für eine neue Wärmepumpe im Haus mit Einliegerwohnung?
Bei zwei Wohneinheiten können Sie insgesamt Kosten in Höhe von 45.000 Euro anrechnen. 30.000 Euro für die erste und 15.000 Euro für die ...
Antwort lesen » -
Kann der Energieberater den iSFP anpassen, wenn sich unsere Pläne geändert haben?
Der bereits beauftragte Energieberater kann die vorhandene Berechnung mit einem vergleichsweise geringen Aufwand anpassen und einen neuen ...
Antwort lesen » -
Wir haben vor der Antragstellung 2024 mit der geförderten Maßnahme begonnen. Gibt es dennoch eine Förderung?
Die BEG-EM-Förderung für neue Fenster bekamen Sie letztes Jahr leider nur, wenn Sie noch keine Maßnahme begonnen hatten. Auch in diesem ...
Antwort lesen » -
Gelten die GEG-Vorgaben für die Dachdämmung für jedes Dach?
Die GEG-Vorgaben zur Dachsanierung betreffen immer nur die tatsächlich behandelten Bauteile. Sanieren Sie das erste Dach, müssen Sie durch ...
Antwort lesen »
Unsere Portalpartner
Handwerker-Suche
Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort