Wie kann ich die Fassade von innen richtig dämmen?
Wir wollen im Bad und im Schlafzimmer jeweils eine Außenwand von innen dämmen. Jetzt haben mir aber zwei verschiedene Leute einen Lösungsansatz bereitet. Der Erste: Auf die Wand eine Lattung, die Zwischenräume mit Mineralwolle ausfüllen, zum Schluss mit OSB und Gips beplanken. Der Zweite, fast ähnlich: Eine Lattung, darauf eine Dampfbremse, dann wieder Lattung mit Mineralwolle ausfüllen und wieder OSB und Gips. Beide Ansätze sind fast gleich. Jedoch habe ich bei einer noch eine Luftschicht, die nicht zirkuliert. Wir müssen ca 10-15 cm dämmen, um die Installation zu verstecken.
Auch wenn er sich ähnlich anhört: Der zweite Lösungsansatz ist bauphysikalisch falsch und sollte so nicht ausgeführt werden.
Aber auch der erste Lösungsansatz ist nicht empfehlenswert: Es fehlt eine Dampfbremse mit feuchtevariablen Eigenschaften, die gleichzeitig eine luftdichtende Funktion übernimmt. Nur so kann die Aufgabe erfüllt werden, den Feuchtetransport in die Dämmung im Winter stark zu bremsen. Im Sommer dagegen besteht bei feuchtevariablen Dampfbremsen ein hohes Trocknungspotenzial durch Rücktrocknung in den Raum.
Für die Bauschadensfreiheit ist jedoch die Luftdichtheit der Konstruktion entscheidend. Daher ist die feuchtevariable Dampfbremse lückenlos zu verlegen und an den Wänden, der Decke und dem Fußboden mit vom Hersteller vorgegebene Klebematerialien luftdicht anzukleben.
Durchdringungen, wie Steckdosen oder wasserführende Installationen in der Dämmschicht sollten vermieden werden. Wasserführende Installationen können, wenn sie in die Dämmebene einer Innendämmung verlegt werden, bei starkem Frost einfrieren. Daher gehören wasserführende Installation von innen gesehen vor die Dämmschicht.
In der Reihenfolge der Montage wäre also folgender Aufbau möglich:
- Lattung,
- erste Lage Mineralwolle zwischen die Lattung,
- Erneute Lattung, quer zur ersten Lattungsebene,
- zweite Lage Mineralwolle zwischen die quer verlegte Lattung,
- lückenlos und luftdicht verlegte feuchtevariable Dampfbremse,
- erneute Lattung als Abstand in der Installationsebene (hier können wasserführende Rohre verlegt werden),
- Gipskartonplatten (ein- oder zweilagig) als Abschluss.
Für das Bad empfehle ich den zusätzlichen Einbau eines feuchtegeregelten Abluftventilators.





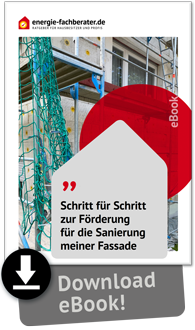
 Jetzt Fachhandwerker vor Ort für die Dämmung Ihrer Fassade finden
Jetzt Fachhandwerker vor Ort für die Dämmung Ihrer Fassade finden